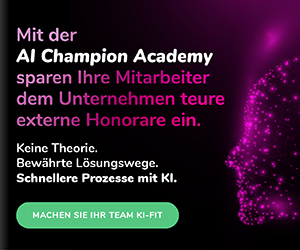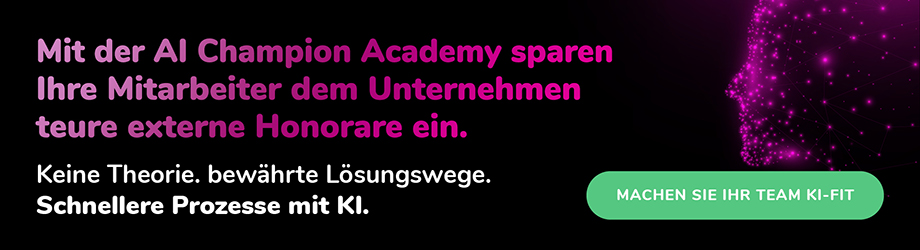Das Apallische Syndrom, umgangssprachlich bekannt als Wachkoma, bezeichnet eine neurologische Erkrankung, die durch schwere Hirnschädigungen verursacht wird. Seit 2009 verwenden Ärzte im deutschsprachigen Raum den Begriff Syndrom reaktionsloser Wachheit (SRW), um Missverständnisse aufgrund der komplexen Differentialdiagnose zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Aktuelles
2022-07-11 – Berufsgenossenschaft muss Kosten für Sexualassistenz übernehmen
Das Sozialgericht Hannover entschied, dass die Berufsgenossenschaft die Kosten für die Sexualassistenz eines Klägers übernehmen muss. Der Mann erlitt nach einem schweren Arbeitsunfall 2003 schwere Verletzungen, darunter ein apallisches Syndrom (Wachkoma). Die Berufsgenossenschaft bewilligte zunächst ein persönliches Budget für Sexualbegleitung, lehnte jedoch den Folgeantrag ab. Das Gericht gab der Klage statt, betont, dass sexuelle Bedürfnisse zu den grundlegenden menschlichen gehören und die Teilhabe am sozialen Leben unterstützen. Selbstbestimmte Sexualität sei daher essenziell für Menschen mit Behinderungen.
Das apallische Syndrom: Ein Zustand zwischen Wachheit und Bewusstseinlosigkeit
Das apallische Syndrom, entsteht durch schwere Schäden am Großhirn oder Teilen davon nach einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Dies führt oft zum vollständigen Ausfall der Großhirnfunktion, während Funktionen des Zwischenhirns, Hirnstamms und Rückenmarks erhalten bleiben. Obwohl Betroffene äußerlich wach erscheinen, ist es unwahrscheinlich, dass sie ein Bewusstsein haben oder effektiv mit ihrer Umwelt interagieren können. Wachkomapatienten haben regelmäßige Schlafphasen wie gesunde Menschen, jedoch ist ihr Tag-Nacht-Rhythmus gestört. Sie können nicht bewusst auf äußere Reize reagieren und haben keine Kontrolle über ihre Darm- und Blasenfunktion, was zu vollständiger Inkontinenz führt.
Ursachen für das Apallische Syndrom
- Hirnschäden, die das Apallische Syndrom verursachen, treten in der Regel bei Schädel-Hirn-Traumata auf, die oft durch Unfälle verursacht werden.
- Auch Hypoxie (Sauerstoffmangel) infolge eines Kreislaufstillstands, beispielsweise bei einem Herzinfarkt, kann das Apallische Syndrom verursachen.
- Es kann auch durch Hirntumoren, Schlaganfälle oder Hirnhautentzündungen verursacht werden und sowohl kurzfristig als auch dauerhaft auftreten.
- Degenerative Erkrankungen wie Alzheimer und die Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung können ebenfalls ein Apallisches Syndrom verursachen.
- Es kann auch mit zerebralen Fehlbildungen einhergehen, was in einem weiteren Artikel näher erläutert wird.
- Charakteristisch für diese Krankheit ist die fehlende Wahrnehmungsfähigkeit der Patienten bei gleichzeitiger Wachheit. Betroffene können nicht mit ihrer Umgebung kommunizieren.
Video: Wachkoma – Der lange Weg zurück ins Leben | WDR Doku
Wie wird ein Apallisches Syndrom diagnostiziert?
Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. schätzt, dass in Deutschland zwischen 10.000 und 12.000 Patienten mit Apallischem Syndrom diagnostiziert sind.
Die Abgrenzung von anderen Krankheitsbildern wie dem Koma gestaltet sich schwierig und führt daher oft zu Fehldiagnosen.
Im Koma verharrt der Patient in einem schlafähnlichen Zustand, aus dem er nicht erweckt werden kann, reagiert jedoch je nach Tiefe des Komas auf äußere Reize wie Schmerz.
Im Gegensatz dazu hat ein Patient im Locked-in-Syndrom eine vollständige Wahrnehmung, ist aber aufgrund vertikaler Augenbewegungen nur begrenzt kommunikationsfähig.
Die Diagnose des Apallischen Syndroms erfordert Langzeitbeobachtungen durch erfahrene Mediziner über mehrere Wochen oder Monate.
Zusätzlich werden bildgebende Untersuchungen wie MRT und EEG durchgeführt, unterstützt durch evozierte Potentiale zur Reizung der Sinnesorgane.
- Ein „persistent vegetativer Zustand“ ist ein anhaltender vegetativer Zustand, der zumindest teilweise rückbildungsfähig ist.
- Ein „permanent vegetativer Zustand“ ist ein dauerhafter vegetativer Zustand, bei dem von einer anhaltenden Schädigung ausgegangen wird.
- Verlust der Fähigkeit, mit der Umwelt in Kontakt zu treten
- Verlust des Bewusstseins über die eigene Person
- Verlust des normalen Schlaf-Wach-Rhythmus
- Verlust von Sprachverständnis und Sprachproduktion
- Verlust der Fähigkeit, gezielt auf externe Reize zu reagieren
- Verlust der Kontrolle über Darm- und Blasentätigkeit (totale Inkontinenz)
- Erhalt der autonomen Reflexe
Diese Symptome zeigt ein Apalliker
Der Ausdruck „Apallisches Syndrom“ wurde erstmals 1940 vom deutschen Psychiater Ernst Kretschmer erwähnt. Diese Krankheit ist durch einen vollständigen Ausfall der Großhirnfunktionen gekennzeichnet, während das Rückenmark, Zwischenhirn und Hirnstamm intakt bleiben. Apalliker zeigen keinerlei Anzeichen eines bewussten Wahrnehmens ihrer Umwelt.
Sie reagieren weder auf:
- Schmerzhafte Reize,
- Visuelle Reize,
- Akustische Reize noch auf Berührungen.
Video: Wachkoma Patienten – Im Koma und doch bei Bewusstsein – Teil 1
Körperfunktionen
Obwohl ein Schlaf-Wachzyklus vorhanden ist, ist dieser beim Apallischen Syndrom häufig gestört. Apalliker können nicht interagieren, Augenkontakt herstellen oder Gegenstände mit ihrem Blick fixieren, obwohl ihre Augen in der Wachphase geöffnet sind. Aphasie (Verlust von Sprachverständnis und Sprechfähigkeit) sowie Harnblasen- und Darminkontinenz sind weitere Merkmale.
Der Hirnstamm und der Hypothalamus sind beim apallischen Syndrom in der Regel nur teilweise betroffen, wodurch der Patient in der Lage ist, lebenswichtige vegetative Körperfunktionen wie Atmung, Kreislauf und Temperaturregulierung nach der Akutphase selbstständig aufrechtzuerhalten. Dies, in Kombination mit medizinischer und pflegerischer Betreuung, sichert das Überleben des Patienten.
Primitive Reflexe
Obwohl einige Apalliker durch äußere Stimulierung primitive Reflexe wie Kopf- und Augenbewegungen oder das Greifen auslösen können, deutet dies nicht auf eine aktive Wahrnehmung hin. Gelegentlich reagieren Betroffene auch mit Körperbewegungen und Mimik auf externe Einflüsse.
Zusätzlich können orale Geräusche wie Schmatzen oder Zähneknirschen auftreten. Diese natürlichen und niederen Reflexe werden von Angehörigen oft fälschlicherweise als bewusste Reaktion des Apallikers interpretiert, was zu Hoffnung auf eine Besserung und Zweifel an der Behandlung durch den Mediziner führen kann.
Fehlende Wahrnehmung
Obwohl die fehlende Wahrnehmung bei Patienten mit diagnostiziertem apallischem Syndrom bisher wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden kann, ist diese Annahme der Mediziner durchaus begründet.
Diese Vermutung lässt sich auch in bildgebenden Verfahren wie der Magnetresonanztomographie (MRT) anhand der nachweisbaren Nervenschäden bestätigen.
Kommunikation mit Apallikern
In den letzten Jahren haben immer mehr Forscher über die Möglichkeit der Kommunikation mit Patienten berichtet, die von einem apallischen Syndrom betroffen sind.
Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, dass eine nonverbale Kommunikation mit Langzeitapallikern (die länger als 18 Monate im Wachkoma sind) nachgewiesen werden konnte.
Britische Studien, veröffentlicht im Fachjournal Science (Ausgabe 313) unter dem Titel „Detecting Awareness in the Vegetative State“, haben gezeigt, dass einige Patienten mit apallischem Syndrom ein Bewusstsein für sich selbst und ihre Umgebung haben.
Diese Erkenntnisse widersprechen nicht nur der Annahme einer fehlenden Wahrnehmung, sondern werfen auch Fragen zur Lebensqualität dieser Patienten auf.
Behandlungsmöglichkeiten des Apallischen Syndroms
Phase A: Akutbehandlung des Apallischen Syndroms
Die Behandlung gliedert sich in mehrere Phasen, beginnend mit der Akutbehandlung in Phase A.
In dieser Phase steht die Sicherung der Lebensfunktionen im Fokus. Dies umfasst Maßnahmen wie die Tracheotomie (Luftröhrenschnitt), die Anlage einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) zur künstlichen Ernährung und gegebenenfalls eines suprapubischen Dauerkatheters (SDK) zur Urinabflusskontrolle.
Ziel dieser Maßnahmen ist die Gewährleistung einer optimalen pflegerischen Versorgung.
Gleichzeitig wird frühzeitig mit der Physiotherapie begonnen, um Folgeerkrankungen wie Lungenentzündungen vorzubeugen und die Schluckfunktion zu fördern, was entscheidend für die Entfernung der Trachealkanüle nach der maschinellen Beatmung ist.
Phase B: Therapieangebote für Apalliker
Nach der Akutversorgung beginnt Phase B, in der das Therapieangebot erweitert wird, um geistige, psychische und motorische Fähigkeiten zu verbessern.
Verschiedene Behandlungsmethoden wie Ergo- und Musiktherapie werden eingeführt, um die Rehabilitation zu unterstützen.
In dieser Phase, die zwischen einem Monat und einem Jahr dauert, wird die Prognose für eine mögliche Heilung des Apallikers bewertet.
Bei deutlicher Verbesserung der physischen und psychischen Leistungen können weitere Rehabilitationsphasen integriert werden (Phasen C/D/E). Bleibt der Patient jedoch bewusstlos, erfolgt der Übergang zur Phase F („Aktivierende Behandlungspflege“).
Heilungsaussichten beim Apallischen Syndrom
Das Apallische Syndrom tritt häufig nach einem Koma auf. Die Prognose für eine mögliche Wiederherstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Ursachen der Erkrankung, das Alter des Patienten und die Dauer des Zustands.
Die Heilungschancen variieren je nach dem Ausmaß der körperlichen und geistigen Schädigung. In den meisten Fällen ist eine vollständige Genesung jedoch unwahrscheinlich. Generell ist die Chance auf Heilung höher, wenn das Apallische Syndrom auf eine äußere Verletzung zurückzuführen ist, anstatt auf eine Erkrankung.
Experten sind sich einig, dass zwölf Monate nach einer Verletzung und drei Monate nach einem krankheitsbedingten Apallischen Syndrom die Aussicht auf Wiederherstellung nahezu ausgeschlossen ist, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern.
Das Apallische Syndrom aus ethischen Gesichtspunkten
Angesichts der Tatsache, dass Patienten mit Apallischem Syndrom möglicherweise Monate oder sogar Jahre überleben, sehen sich sowohl behandelnde Mediziner als auch Angehörige mit komplexen ethischen, ökonomischen und sozialen Fragen konfrontiert.
Unabhängig davon, ob der Patient in einer Langzeitpflegeeinrichtung untergebracht ist oder, wie in 70% der Fälle in Deutschland, von Familienmitgliedern betreut wird, stellt der wahrnehmungs- und kommunikationsfreie Zustand der Apalliker eine erhebliche psychische Belastung für alle Beteiligten dar.
Besonders herausfordernd ist die Tatsache, dass der Patient bei angemessener Pflege und stabilem Gesundheitszustand, selbst ohne Aussicht auf Heilung, möglicherweise bis zu fünf Jahre weiterleben kann, ohne sein eigenes Leiden zu empfinden.
Video: Koma: Was überhaupt ist das & wieviel können Betroffene im künstlichen Koma mitbekommen?
Sterbehilfe für Apalliker?
Die Frage nach Sterbehilfe für Apalliker ist äußerst komplex und wirft viele ethische, rechtliche und moralische Fragen auf.
Aufgrund des schweren Zustands von Apallikern, der durch den Verlust jeglicher Wahrnehmung und Kommunikationsfähigkeit gekennzeichnet ist, gibt es kontroverse Diskussionen über die Rechtfertigung einer aktiven Beendigung ihres Lebens.
Einige argumentieren, dass die Fortsetzung des Lebens eines Apallikers ohne Aussicht auf Genesung und mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität unmenschlich sein könnte.
Sie vertreten die Ansicht, dass in solchen Fällen die Sterbehilfe eine humane Option sein könnte, um dem Patienten unnötiges Leiden zu ersparen und den Angehörigen eine schwere Last zu nehmen.
Andere hingegen sehen Sterbehilfe als ethisch problematisch an und betonen die Würde des menschlichen Lebens, unabhängig von seinem Zustand.
Sie argumentieren, dass das Leben eines Apallikers auch ohne Bewusstsein und Kommunikation weiterhin einen intrinsischen Wert hat und dass es Aufgabe der medizinischen Versorgung und Pflege ist, das Leben so würdevoll wie möglich zu gestalten.
Die Gesetzgebung zu diesem Thema variiert je nach Land und kann von restriktiven Gesetzen bis hin zu einer begrenzten Zulassung von Sterbehilfe reichen.
Letztendlich ist die Frage nach Sterbehilfe für Apalliker eine sehr persönliche und individuelle Entscheidung, die sowohl ethisch als auch moralisch sorgfältig abgewogen werden muss.
Unterstützung für Angehörige
Die Betreuung und Pflege eines erkrankten Familienmitglieds kann eine immense Herausforderung für Angehörige darstellen. In solch schwierigen Situationen ist es oft hilfreich, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und über die eigenen Erfahrungen, Sorgen und Ängste zu sprechen.
Video: So hat es LUDWIG (24) aus dem WACHKOMA zum TANZLEHRER geschafft | SAT.1 Frühstücksfernsehen | TV
Bundesverband Schädel-Hirnpatienten in Not e.V.
Der Bundesverband Schädel-Hirnpatienten in Not e.V. bietet auf seiner Website eine umfassende Liste bundesweiter Selbsthilfegruppen an. Zusätzlich steht eine Notruf- und Beratungszentrale unter der Telefonnummer 0 96 21/6 48 00 zur Verfügung.
SelbstHilfeVerband – Forum Gehirn e.V.
Der SelbstHilfeVerband – Forum Gehirn e.V. unterstützt Betroffene und ihre Angehörigen auf seiner Website und bietet Hilfe bei der richtigen Pflege sowie der Inanspruchnahme der ihnen zustehenden Hilfsmittel.
Fazit
Das Apallische Syndrom stellt eine radikale Veränderung im Leben der Betroffenen dar. Es resultiert aus schweren Hirnschädigungen und führt zu einem Zustand, in dem grundlegende Funktionen des Gehirns ausfallen, während andere erhalten bleiben. Die Diagnose ist oft schwierig und kann zu Fehleinschätzungen führen. Dennoch helfen klare diagnostische Kriterien dabei, das Syndrom genau zu identifizieren. Die Auswirkungen auf das tägliche Leben sind enorm, und sowohl Patienten als auch Angehörige müssen lernen, mit den Herausforderungen umzugehen und nach Wegen zu suchen, die Lebensqualität bestmöglich zu erhalten.